Die neue Kirchenlehre

Wir sind im Jahr 2100 mit Blick auf die „Alte Kirche“vor 2030. Die neue Kirchenlehre orientiert sich wieder an Jesus Christus.
Die als starr empfundene und schwer veränderbare Kirchenlehre vergangener Jahrhunderte war vermutlich eine der Ursachen für den Rückgang der Mitgliederzahlen beider großer Konfessionen in Deutschland. Eine sich stetig wandelnde Welt erforderte eine flexible Anpassung menschlichen Denkens und Handelns. Auf die Kirchenlehre der Zukunft bezogen bedeutete das: Einzelne Reformen reichen nicht aus. Die Kirche, genauer gesagt die Menschen, brauchten eine radikale Erneuerung der Kirchenlehre, die ihrer Zeit gerecht wird, verstanden wird und neue Perspektiven eröffnet. Ein weites Feld, das zu bearbeiten war.
Inhalt
Vorbild statt Dogmatismus
Heute präsentiert sich die Kirche als offene, inklusive und dynamische Institution, die dogmatischen Ballast abgeworfen hat. Sie ist kein Machtinstrument mehr, sondern ein Raum der Inspiration, Reflexion und ethischen Orientierung. Nur durch diese grundlegende Erneuerung konnte sich die Kirche vor einer zunehmenden gesellschaftlichen Marginalisierung bewahren und zu einer moralischen Instanz des 22. Jahrhunderts werden.
Die christliche Mission wurde früher mit der Verbreitung dogmatischer Lehrsätze assoziiert. Doch Jesus selbst wirkte nicht durch aufgezwungene Glaubenssätze, theologische Rechtfertigungen oder starre Rituale, sondern durch sein gelebtes Beispiel. Pädagogen und Eltern wissen seit jeher: Kinder lernen durch Vorbilder weit effektiver als durch Belehrung, Drohung oder Verbote. Eine Kirche, die sich an Jesu Vorbild orientieren will, muss mit gutem Beispiel vorangehen. Das hieß konkret, dass ihre Glaubensbotschaft durch gelebte Nächstenliebe statt Ausgrenzung, durch Gerechtigkeit statt materieller Orientierung und durch Demut statt autoritärem Anspruch zu verkörpern ist.
In einer pluralistischen Gesellschaft kann die Kirche nur dann relevant bleiben, wenn sie als moralisches Vorbild wahrgenommen wird. Das bedeutet, sich für die Schwachen einzusetzen, soziale Gerechtigkeit zu fördern, Gemeinschaft zu stiften und diese Werte glaubwürdig vorzuleben. Dabei muss die Rolle Jesu als Inspirationsfigur gestärkt und darf nicht als dogmatische Rechtfertigung kirchlicher Lehren missbraucht werden.
Überprüfung der Lehre statt Inquisition
Eine lebendige Kirche musste bereit sein, sich selbstkritisch zu hinterfragen. Dogmen, die vor Jahrhunderten formuliert wurden, müssen nicht unverändert für alle Zeiten als verbindlich gelten. Daher war die Einrichtung unabhängiger Ethik- und Theologiekommissionen notwendig, die die kirchliche Lehre regelmäßig überprüfte und Reformvorschläge erarbeitete. „Die gibt es schon!“, sagten die Kleriker damals. Ja, die gab es tatsächlich schon seit dem Mittelalter, bekannt als Inquisition. Allerdings lag der Fokus damals auf der systematischen Verfolgung und Bestrafung von sogenannten Häretiker/-innen, was häufig mit schwerwiegenden Repressionen bis hin zur Todesstrafe verbunden war.
Die Hässlichkeiten dieser Zeit bis zum Ende des 18. Jahrhunderts sind hinlänglich bekannt. Das Image der „Kongregation der römischen und allgemeinen Inquisition“ war ruiniert und daher mehrfach umbenannt. Heute ist es das „Dikasterium für die Glaubenslehre“, mit ähnlicher Aufgabe, aber weniger brutalen Methoden. Es muss niemand mehr um sein Leben fürchten, weil die Kirche die Macht dazu verloren hat. Aber der Entzug der Lehrerlaubnis, Predigtverbote oder das zurückversetzen von Priestern in den Laienstand waren bis zum ersten Viertel des 21. Jahrhunderts gängige Praxis.
Papst Franziskus berief 2023 den als liberal geltenden Kardinal Víctor Fernández zum Präfekten des Dikasteriums für die Glaubenslehre. Aber nur diese Personalentscheidung ohne strukturelle Umgestaltung brachte keinen wirklichen Fortschritt. Das Gremium bestand damals aus 29 hochrangigen Kardinälen und Bischöfen und immerhin sechs theologisch konservativ orientierte Laien, darunter auch Frauen. So blieb die Zusammensetzung mehrheitlich innerhalb traditioneller Strukturen und verhinderte tiefgreifende Veränderungen.
Angesichts der künftigen Aufgaben wurden solche Kommissionen im Zuge der Neuausrichtung ab 2030 paritätisch und interdisziplinär besetzt. Ihr gehörten Theologen, Ethiker, Sozialwissenschaftler und vor allem Vertreter des Kirchenvolkes an. Das Gremium bestand also auch aus bodenständigen Menschen, die noch Kontakt zur realen Gesellschaft hatten. Ihre Aufgabe ist es heute, dogmatische Lehrsätze auf ihre Notwendigkeit und ggf. auf ihre Vereinbarkeit mit den Anforderungen und Bedürfnissen der Menschen zu prüfen. Damit soll sichergestellt werden, dass die Kirche nicht mehr in eine starre Institution zurückfällt, sondern sich dynamisch weiterentwickelt.
Das Dilemma bestand bis 2030 darin, dass die Kirche auf allen Ebenen, also von der Gemeinde über Bistum bis zur römischen Kurie, Entscheidungsgremien so besetzte, dass Geistliche die Geschicke bestimmten. Und sollte das Kirchenvolk einmal etwas gegen den Willen der höheren Instanz beschlossen haben, griff ein Vetorecht (Synodaler Weg). So konnte man nur Frustration erzeugen, aber keine Diözese und noch weniger eine weltumspannende Institution führen.
Konservative aus der Führungsriege befürchteten damals, in der Planungsphase der Erneuerung 2030, einen „Ausverkauf“ des Christentums, wenn sich die Kirche „dem Zeitgeist beugte“. Der Papst aber, für seine Aufgeschlossenheit zum Menschen und seine geistige Öffnung der Kirche bekannt, erlegte den Skeptikern eine Klausur auf. Darin sollten sie sich folgende Fragen offen und aufrichtig beantworten:
• Steht eine konkrete Forderung an die Kirche der Kirchenlehre entgegen? Dann wäre die Lehre zu überprüfen, denn sie steht viel zu oft im Widerspruch zum Beispiel Jesu.
• Steht eine konkrete Forderung dem Geist Jesu entgegen? Dann wäre Skepsis wahrlich gerechtfertigt. Allerdings erst nach Berücksichtigung der damaligen Gesellschaftsordnung und kritischer Prüfung der Überlieferungen. Wir müssten reden.
• Was bewirkt ein starres Festhalten an alten Lehren? Treiben wir die Kirchenaustritte in den westlichen Ländern weiter an und sind dort in naher Zukunft eine unbedeutende Sekte? Wollen wir gleichzeitig unzähligen Splittergruppen und religiösen Vereinen das Feld überlassen? Wäre das im Sinne Jesu oder wäre es Verrat an seiner Kirche?
Ethische Neubesinnung
Die heutigen moralischen Vorstellungen der Kirche im Jahr 2100 spiegeln eine Balance zwischen Tradition und Fortschritt wider. Ziel bleibt es, sowohl dem Einzelnen als auch der Gemeinschaft in einer sich stetig wandelnden Welt eine praktizierbare, moralische Orientierung anzubieten.
Besonders sichtbar wird dies in der Rolle der Frau: Heute selbstverständlich, war es lange undenkbar, dass Frauen Zugang zu allen kirchlichen Ämtern haben. Gleiches gilt für die Anerkennung queerer Menschen, die lange Zeit ausgeschlossen wurden. Diese Öffnung wurde nicht ohne interne Konflikte vollzogen, doch sie wurde als notwendig erachtet, um den moralischen Werten von Gerechtigkeit und Nächstenliebe gerecht zu werden.
Technologische und ethische Herausforderungen
Die rasante Entwicklung der künstlichen Intelligenz, der Gentechnik und der digitalen Welt hat viele ethische Fragen aufgeworfen, mit denen sich die Kirche auseinandersetzen musste. Anfänglich selbst orientierungslos ob der rasanten Entwicklung, hatte die Kirche bis zum Jahr 2040 eine klare Haltung entwickelt. Sie erkannte die Vorteile dieser Technologien an, mahnte jedoch zu einem verantwortungsvollen Umgang, der die Würde des Menschen bewahrt.
Gentechnische Eingriffe werden unter ethischen Gesichtspunkten bewertet: Heilungsmaßnahmen und Krankheitsprävention gelten als moralisch vertretbar. Der Manipulation des menschlichen Erbguts zur Verbesserung bestimmter Eigenschaften steht die Kirche aber weiterhin ablehnend gegenüber.
Familie und Ehe
Das Verständnis von Familie und Partnerschaft hat sich bis heute stetig diversifiziert. Die Kirche hat ihre Haltung gegenüber gleichgeschlechtlichen Beziehungen, geschlechtsneutralen Identitäten und alternativen Familienmodellen angepasst. Selbstverständlich ist die traditionelle Ehe nach wie vor die Norm. Aber die kirchliche Gemeinschaft schließt alle Menschen ein, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität. Dazu gehören natürlich auch queere Menschen, weil sie schließlich so geschaffen sind, wie sie sind – göttlich und gut.
Auch die Geschlechterrollen innerhalb der Ehe wurden von den traditionell verhärteten Vorstellungen befreit. Im Sinne einer Geschlechtergerechtigkeit gibt es keine geistige Rollenvorgabe mehr. Mann und Frau bringen sich nach ihren Neigungen und Fähigkeiten in die Beziehung ein.
Scheidung war früher nur im Durchlaufen eines langwierigen Verfahrens möglich, in dem die Ehe unter bestimmten Umständen für ungültig erklärt werden musste. Heute genügt ein geistliches Gespräch, in dem der Priester die Scheidungswilligen berät. Die Kirche respektiert heute, dass Menschen sich verändern und sich im Laufe der Zeit möglicherweise auch unterschiedlich entwickeln. So bleiben Geschiedene menschlich anerkannte Vollmitglieder der Gesellschaft und ganz besonders der Kirche.
Sexualmoral
Als wahrer Durchbruch galt damals die Öffnung zu einer unbefangenen Sexualmoral. Früher war Sexualität nur innerhalb der Ehe und nur zu Fortpflanzungszwecken erlaubt. Lust galt als Sünde und Homosexualität sowieso. Letzteres wurde noch nicht einmal ausgesprochen. Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962–1965) hinterfragte die Kirche ihre Haltung zur Sexualmoral, insbesondere in Bezug auf Themen wie Verhütung, Scheidung und Homosexualität. Eine vorsichtige Lockerung wurde immer wieder thematisiert, aber nie beherzt vollzogen.
Heute, 60 Jahre nach der Neufassung ihres ethischen Gerüstes, blicken viele Kirchenverantwortliche selbstkritisch auf die begrenzte Reformbereitschaft früherer Generationen zurück. Die Kirche hat sich in jeder Hinsicht geöffnet, so auch im Blick auf ihre Sexualmoral. Dank des aufgehobenen Zölibats und freier Gedanken mit dem Segen der Kirche sind Seelsorgerinnen und Seelsorger heute qualifizierte Gesprächspartner auch in Fragen der Sexualität.
Queere Menschen dürfen sich outen, ohne auch nur gedankliche Konsequenzen zu befürchten. In Verhütungsfragen gibt es keine Reglementierung. Familienplanung ist nicht nur sinnvoll (in Teilen der Dritten Welt gar existentiell), sondern absolute Privatsache und als solche respektiert. Die Geschlechterrollen sind auch in den Köpfen aufgehoben, der Zölibat ist Geschichte und die Geistlichen sind in der Lage, über die früher so „schmutzigen“ Themen unbefangen und aus Erfahrung zu sprechen.
Die gegenwärtig kontrovers, aber respektvoll diskutierten Themen der Zukunft sind Genetik, Fortpflanzungsmedizin und immer noch die Frage der Abtreibung.
Soziale Gerechtigkeit und Ökologie
Ein weiteres zentrales Anliegen der erneuerten Kirche ist die soziale Gerechtigkeit. Angesichts der globalen Herausforderungen, die durch Klimawandel, Migration, wirtschaftliche Ungleichheit und Kriege entstanden sind, setzt sich die Kirche verstärkt für eine gerechtere Verteilung von Ressourcen ein. Ihre Moralvorstellungen haben sich dahingehend entwickelt, dass sie nicht nur individuelle ethische Fragen, sondern auch die Verantwortung gegenüber der Schöpfung und damit der gesamten Menschheit in den Vordergrund rückt. Umweltethik ist zu einem festen Bestandteil der kirchlichen Lehre geworden und nachhaltiges Handeln moralische Pflicht.
Papst Franziskus hat mit der Umweltenzyklika „Laudato si“ schon im Jahr 2015 klar Stellung bezogen: Alles ist miteinander verbunden – Umwelt, Gesellschaft, Wirtschaft, Spiritualität. „Die Erde, unser Haus, scheint sich immer mehr in eine unermessliche Mülldeponie zu verwandeln.“ – Laudato si’, Nr. 21
Heute setzen die Vertreter des Kirchenvolkes die Themen. Es sind gewählte Abgeordnete aus Gemeinden und Landesverbänden, die sich regelmäßig beraten und ihre Interessen in die Politik einbringen.
Das Verhältnis zur Wissenschaft
Die einstigen Spannungen zwischen Kirche und Wissenschaft sind überwunden. Heute erkennt die Kirche die wissenschaftlichen Fortschritte als essenziell für das menschliche Wohlergehen an und arbeitet aktiv mit Wissenschaftlern zusammen, um ethische Richtlinien für neue Entwicklungen zu formulieren. Die Kirche greift wissenschaftliche Erkenntnisse auf und ist bereit, Erwiesenes in ihrer Lehre zu berücksichtigen. Dies gilt auch für theologische Erkenntnisse, da sich die Amtskirche nicht mehr scheut, überholte Lehren zurückzunehmen.
Mystisches Weltverständnis
Für christliche Mystiker ist die Einheit mit Gott schon im Diesseits möglich. Die Kirche hat jedoch vorsichtig oder sogar ablehnend auf solche Ansätze reagiert, weil sie schwer zu kontrollieren waren und das etablierte Lehrsystem konterkarierten. Der kirchliche Glaube setzte auf die Trennung von Gott und Mensch, auf eine lineare Heilsgeschichte: Schöpfung → Sünde → Erlösung → Paradies nach dem Tod. Mystik hingegen spricht von einem „Jetzt“, einer unmittelbaren Gegenwart Gottes, die jenseits von Konzepten liegt. Man könnte also sagen: Die Theologie erklärt Gott, die Mystik erfährt Gott.
Die mystische Sicht auf die Dinge hat die Vorstellung von Gott als einem personalen, allwissenden und allmächtigen Wesen hin zu einem transzendenten, sich entwickelnden Prinzip des Seins gewandelt. Gott wird heute von vielen nicht mehr als außerhalb der Welt stehend verstanden, sondern als integraler Bestandteil des Universums, als das Prinzip der Liebe, der Schöpferkraft und der Verbundenheit allen Lebens in uns, als Teil von uns. Im nächsten Kapitel werden wir uns eingehend mit dieser Geisteshaltung befassen.
Offenbarung und Heilige Schriften
Das neue Testament wurde traditionell als historisches Zeugnis christlicher Offenbarung, d.h. als Selbstmitteilung Gottes an die Menschheit präsentiert. Im langen Lauf der Zeit werden neue Schriften entdeckt und anerkannte Evangelien mit neuen Methoden auf ihre Authentizität überprüft. KI-gesteuerte Algorithmen können biblische Texte analysieren und Vergleiche zwischen verschiedenen Schriften ziehen. Dabei wurden immer wieder Übersetzungsfehler oder fiktive Zuspitzungen festgestellt und sogar Fälschungen entlarvt. Die Erzählungen aus dem Neuen Testament sind also nicht unumstritten.
Die Bedeutung der Bibel hat noch aus einem anderen Grund ihren Stellenwert als absolute Wahrheit verloren: Durch kontemplativ-mystische Interessen und die sich daraus gebildeten Bewegungen haben sich die Schwerpunkte in der Glaubenspraxis verschoben. Viele sehen in der mystischen Betrachtung klarer, als es ihnen durch das Lesen von Bibeltexten möglich ist. Dennoch wird sie als Quelle der Weisheit immer noch hoch geschätzt.
Religiöse Praxis
Die Sakramente – Taufe, Eucharistie, Firmung, Buße, Krankensalbung, Weihe und Ehe – waren das Herzstück der katholischen Glaubenspraxis. Die exklusive Spende durch Priester überhöhte die Geistlichen und unterstrich die Bedeutung aus Kirchensicht als „sichtbares Zeichen unsichtbarer Wirklichkeit“. Aus heutiger Sicht gilt das gesamte Universum als Sakrament. Die sieben früheren Sakramente sehen die Gläubigen heute als eine Segnung, die von jedem gläubigen Menschen ausgehen kann.
Die Gottesdienste – noch bis 2040 überwiegend streng kategorisiert in „Eucharistiefeier“ und „Wortgottesdienst“ – gelten heute gleichwertig als „Feier des Lebens“. Da die Gottesdienste wegen des Mangels an Hauptamtlichen meist von Laienpriester/-innen aus den Reihen der Gemeinde geleitet werden, wird die Form dieser Gottesdienste zusehends vielfältiger und ideenreicher. Diese Vielfalt wird von der Mehrheit der Besucher als erfrischend wahrgenommen. Eine kurze Reflexion und (auch kritische) Anmerkungen, verbunden mit alternativen Vorschlägen, nimmt der Priester nach dem Gottesdienst als willkommenes Korrektiv dankbar an. Das führt zu besonders lebendigen Feiern mit hoher Präsenz und innig verbundener Gemeinschaft.
Für die Form der Gottesdienste gibt es zwar Vorschläge, aber jede/r Priester/-in gestaltet die Feier nach eigenem Verständnis: als traditionelle Eucharistiefeier mit Segnung von Brot und Wein, als meditative Andacht in weitgehender Stille, als kontemplativen Gottesdienst mit geistigen Impulsen, als Schweigewanderung mit Feldgottesdienst usw.




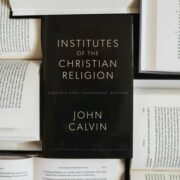





Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!