Befreit glauben – ohne Angst

Die Geschichte der Menschheit ist durchzogen von der Suche nach Sinn, Orientierung und spiritueller Erfüllung. Zwei Jahrtausende lang erhob die katholische Kirche den Anspruch, den einzig wahren Zugang zu diesen existenziellen Fragen zu besitzen. Dabei kam es im Namen kirchlicher Autorität auch zu Gewaltanwendung und Druckausübung, die heute kritisch gesehen werden. Sünde, Schuld und Angst vor Bestrafung sind in den Gläubigen noch heute tief verankert. Während sich Gesellschaft, Wissenschaft und Moral weiterentwickeln, zeigte sich die Kirche in vielen Bereichen nur sehr langsam veränderungsbereit. Kann sie so ihrer zentralen Aufgabe, der Seelsorge, gerecht werden?
Inhalt
Angst verhindert Vertrauen
Angst ist ein natürliches Schutzgefühl; jeder Mensch kennt es. Sie kann lähmen, warnen oder aufrütteln. In vielen Lebenssituationen steht die Angst wie eine Mauer zwischen uns und dem Vertrauen – auch dem Vertrauen auf Gott. Doch was passiert, wenn Angst zur Fessel wird, die uns hindert, wirklich an Gott zu glauben – IHM zu vertrauen? Dann hält sie uns gefangen, macht uns misstrauisch, eng und handlungsunfähig. Manche Menschen können sich nicht ganz auf Gott einlassen, weil sie befürchten, Kontrolle zu verlieren oder Schwäche zu zeigen. In einer Gesellschaft, die nach Leistung, Sicherheit und Selbstbestimmung strebt, wirkt der Glaube wie ein Wagnis – ein „Sich-Fallenlassen“ ohne alle Sicherheiten. Die Angst fragt ständig „Was ist, wenn…?“ – statt zu sagen: „Ich vertraue“. Der Glaube aber lebt vom Gottvertrauen, das uns freier leben lässt.
Gerade in schwierigen Zeiten zeigt sich, wie tief unser Glaube wirklich reicht. Die Angst flüstert uns: „Du bist allein“, der Glaube aber antwortet: „Ich bin bei dir“. Gottvertrauen lässt Trost, Mut und neue Kraft wachsen. Wer sich von Angst fesseln lässt, verliert den Blick für dieses Vertrauen. Stellen wir uns der Angst, kann aus der Fessel eine Brücke werden – hin zu einer tieferen Gottesbeziehung.
Angst als Mittel der Einwirkung
Die Angst vor göttlicher Strafe, dem „jüngsten Gericht“, wirkt auch heute noch nach und sie ist tief verinnerlicht – als Folge der religiösen Erziehung. Sie basiert nicht auf einer authentischen Gottesbeziehung, sondern auf erlernten Schuldmustern. Heute plagt viele das „schlechte Gewissen“, das in vielen Liedern und Gebetstexten kultiviert wird. Viele Gläubige – besonders ältere – berichten, dass sie selbst nach Jahrzehnten innerlich zusammenzucken, wenn sie die Kommunion „nicht würdig“ empfangen. Sätze wie „oh Herr, ich bin nicht würdig…“ können bei vielen Menschen negative Selbstbilder verstärken. Dann sind sie Gift für die Seele – und sie wirken nachhaltig belastend.
Die Kirche mag Angst und Gewissensbisse nicht bewusst schüren, verwendet in liturgischen Texten aber weiterhin Formulierungen, die bei manchen Gläubigen Angst auslösen oder alte Schuldgefühle reaktivieren können. Es stellt sich die Frage, warum nicht verstärkt darauf hingearbeitet wird, solche Sorgen aktiv zu entkräften – auch von höchster Stelle. Wenn die Kirche selbst an einen liebenden Gott glaubt, müsste sie die Hälfte der Gebete und Kirchenlieder vom „Jammertal“ entsorgen.
Die Erbsündenlehre, die kindliche Prägung durch drohende Höllenvorstellungen, die Darstellung Gottes als gestrenger Richter: Das sind keine harmlosen Glaubensbilder, sondern psychologisch prägende Narrative, die bis ins Erwachsenenalter wirken. Sie erzeugen eine Art „spirituelle Paranoia“, die Glauben nicht freisetzt, sondern lähmt. Wer Gott fürchtet, kann kaum lieben. Und wer sich permanent schuldig fühlt, findet schwer in die Weisheit des Evangeliums.
Diese Angst mag aus Sicht der Kirche in früheren Zeiten nützlich gewesen sein. Sie sicherte immerhin Gehorsam, unterdrückte Fragen und galt zudem als erzieherisches Mittel. Sie garantierte in den schlimmsten Zeiten aber auch Einnahmen: Spenden, Erbschaften, Kirchensteuern, Kauf von Ablässen – oft aus einem Gefühl der Sühne heraus geleistet.
Angst – wirklich im Sinne Jesu?
War es wirklich Jesu Anliegen, eine Religion der Furcht zu gründen? Hat er Menschen mit der Hölle bedroht – oder hat er sie mit Liebe umarmt? Ging es ihm um Angst vor der Hölle – oder um das Reich Gottes mitten unter uns? Jesus stellte Konventionen in Frage, durchbrach religiöse Exklusivität und näherte sich den Ausgegrenzten. Seine Botschaft war radikal inklusiv. Jesus stand für geistige Freiheit. Statt die Freiheit zu fördern und zu feiern, hat die Kirche sie reguliert. Statt sie zu verkünden, wurde sie bewacht. Statt zu vertrauen, wurde Gehorsam eingefordert.
Die Angst war ein institutionelles Werkzeug, um das „Heilige“ abzusichern. Doch der Preis war hoch: Die innere Entfremdung vieler Gläubiger. Die Flucht aus einer Kirche, die mehr einschüchterte, als inspirierte.
Zaghafte Öffnung – reicht das?
Das Zweite Vatikanische Konzil (1962–1965) versuchte, erste Korrekturen vorzunehmen: Es betonte das allgemeine Priestertum aller Getauften und initiierte neue Formen von Liturgie und Dialog. Doch die Grundstruktur blieb bestehen: Die Angst wurde nicht abgeschafft – nur anders verpackt. Geblieben ist zumindest das „schlechte Gewissen“. Papst Franziskus öffnete Fenster und Türen, doch zentrale kirchliche Positionen, die von manchen als angstbehaftet empfunden werden, blieben unangetastet.
Wie glaubwürdig ist eine Kirche, die einerseits Barmherzigkeit predigt und andererseits homosexuelle Partnerschaften „in sich ungeordnet“ nennt? Die Mitbestimmung verspricht, aber das Frauenpriestertum mit einem „Nein für alle Zeit“ blockiert? Dies kann als Ausdruck institutioneller Unsicherheit gegenüber gesellschaftlichem Wandel interpretiert werden. Dann ist es keine Angst der Gläubigen mehr – sondern die Angst der Institution vor Kontrollverlust.
Die Zukunft des Glaubens liegt aber nicht in der Rückkehr zu alten Sicherheiten, sondern in der Befreiung von überholten Angstmechanismen. Eine geistlich gesunde Kirche müsste:
• Den liebenden Gott ohne Angstbilder vermitteln,
• theologische Vielfalt aushalten,
• spirituelle Freiheit über kirchliche Kontrolle stellen,
• Schuldnarrative durch Versöhnung und Verantwortung ersetzen,
• Macht nicht durch Weihe, sondern durch Vertrauen legitimieren.
Glaube kann nur da lebendig werden, wo Menschen keine Angst haben müssen, Gott zu begegnen.
Aber nicht alles, was aus der kirchlichen Tradition stammt, ist negativ. Viele Menschen haben in der Kirche Trost gefunden, Heimat erlebt, Gemeinschaft gespürt. Liturgische Rituale, biblische Texte und jahrhundertealte Gebete können heilsam wirken – wenn sie im Geist der Liebe und nicht der Einschüchterung formuliert sind. Wo Kirche zuhört, begleitet und inspiriert, entfaltet sie großes spirituelles Potenzial. Es gibt Gemeinden, Ordensgemeinschaften und pastorale Initiativen, die befreienden Glauben leben – oft entgegen der starren Strukturen. Sie zeigen: Es geht auch anders.



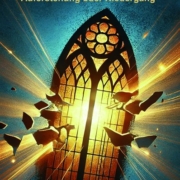






Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!