Die Evangelien
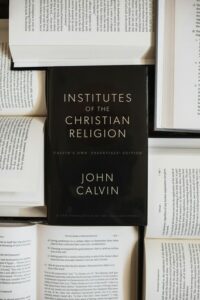
Die Evangelien, die ersten vier Bücher des Neuen Testaments, erzählen die überlieferten Berichte über das Leben, die Lehren, das Wirken und den Tod Jesu Christi. Die Weisheit der Evangelien ist unumstritten. Es gibt jedoch auch umstrittene Passagen bzw. solche, die nur mit phantasievoller Interpretation als weise Botschaft taugen. Wie glaubwürdig sind die Evangelien angesichts zahlreich möglicher Fehlerquellen?
Inhalt
Patriarchale Gesellschaft
Ein grundlegendes Problem bei der Interpretation der Evangelien ist ihre zeitversetzte Verfassung. Die Evangelien wurden nicht sofort nach den Ereignissen geschrieben, sondern etwa zwischen 65 und 100 n. Chr. verfasst. Dies bedeutet, dass sie nicht nur aus erster Hand berichten, sondern auf mündlichen Überlieferungen, schriftlichen Quellen anderer Verfasser und nur zum kleinen Teil auf den Erinnerungen der Autoren basieren. Diese zeitliche Distanz kann zu Verzerrungen oder Veränderungen der ursprünglichen Ereignisse führen.
Zu Zeiten Jesu hatten die Frauen kaum Rechte. Sie hatten den Männern zu dienen und zu gehorchen. In weiten Teilen des öffentlichen Lebens waren Frauen ausgeschlossen. Sie hatten im allgemeinen kaum Zugang zu Bildung. Das Schreiben (auch der Evangelien) blieb somit Männern vorbehalten. Frauen hätten sicherlich sehr viel anders geschrieben!
Nun stellt Jesus plötzlich das Frauenbild in Frage. Jesus zeigt sich in der Öffentlichkeit mit Frauen und spricht sie sogar an. Das war zu damaliger Zeit eine Ungeheuerlichkeit! Jesu besonders enge Beziehung zu Maria Magdalena ist unbestritten. Dass er sie und weitere Frauen zu seinem Jüngerkreis zählte, wird in den Evangelien nur zurückhaltend dargestellt, obwohl einige Texte Frauen als enge Vertraute Jesu zeigen. Das mag daran liegen, dass Jesus innerhalb der bestehenden gesellschaftlichen Strukturen agierte und selbst er diese Jahrtausende alte Gesellschaftsordnung nicht vollständig bezwingen konnte. Die Evangelisten waren Männer und es darf bezweifelt werden, dass sie die Botschaft Jesu zur Stellung der Frau in der Gesellschaft sowie auch als seine Jüngerinnen mutig und authentisch niedergeschrieben haben. Das Geschriebene musste ja halbwegs zum gesellschaftlichen Mainstream passen.
Fälschungen
Texte der religiösen Absicht und dem gesellschaftlichen Zeitgeist „anzupassen“, war in der Antike verbreitet und galt als legitim. Das dürfte auch für die Evangelien gelten, obwohl bewusste und böswillige Fälschungen seitens der Kirche nicht nachzuweisen sind. Originale Handschriften gibt es nicht. Allerdings gibt es Kopien (von Kopien von Kopien…), stellenweise mit späteren „Ergänzungen oder theologischen Akzentsetzungen“ versehen, wie die Bibelwissenschaft durch Textvergleiche zeigt.
Im Zuge der kirchlichen Überlieferungsgeschichte gab es „Anpassungen“ und redaktionelle Entscheidungen, die theologische Leitlinien widerspiegeln. Einige Textänderungen wurden möglicherweise vorgenommen, um theologische Positionen zu stützen bzw. die Kirchenlehre nicht ins Wanken zu bringen. Die Bibelwissenschaft macht Textteile kenntlich, die als nicht original zu werten sind. Überlieferungsfehler und theologische Auslegungen führten zu unterschiedlichen Textfassungen (z. B. in der lateinischen Vulgata von Hieronymus im 4. Jahrhundert; Ehebrecherin: Johannes 7,53 – 8,11; trinitarische Formel in 1. Johannes 5,7; Bei Markus fehlen die Verse 16,9–20 in den ältesten Texten).
Der evangelische Theologe und Professor für Neues Testament, Gerd Lüdemann, beklagte 1991 in seinem Buch „Das unheilige in der Heiligen Schrift“, dass 85% der Überlieferungen aus unterschiedlichen Gründen nicht den Worten Jesu entsprechen. Der anerkannte Philosoph und Theologe Christoph Türcke sagt: „Die Leiche im Keller des Christentums ist der vergottete Jesus selbst“ (Türcke 1996: 144).
Übersetzungsfehler
Die Evangelien sind durch Übersetzungen in verschiedene Sprachen und kulturelle Kontexte gegangen. Jede Übersetzung birgt das Potenzial für Fehler oder Interpretationsunterschiede. Während Übersetzer ihr Bestes tun, um den ursprünglichen Sinn der Texte zu bewahren, können sprachliche Nuancen verloren gehen oder falsch verstanden werden, was zu unterschiedlichen Interpretationen führt. Dies ist besonders relevant, wenn es um theologisch komplexe oder mehrdeutige Passagen geht, die Raum für Interpretation lassen.
Auswahl und Ausschluss
Ein weiterer Aspekt ist die Auswahl bestimmter Evangelien für den neutestamentlichen Kanon. Obwohl es zahlreiche Evangelien gibt, wurden nur vier – Matthäus, Markus, Lukas und Johannes – in den offiziellen Kanon aufgenommen. Andere Evangelien, wie z.B. das Thomasevangelium oder die Evangelien von Maria Magdalena, Judas, Petrus, Jakobus oder Philippus wurden als apokryphe (verborgene) oder nicht-kanonische Texte betrachtet und aus verschiedenen theologischen, kirchengeschichtlichen, vielleicht auch kirchenpolitischen Erwägungen ausgeschlossen. Viele der verborgenen Evangelien haben einen mehr oder weniger gnostischen Hintergrund (gnostische Strömungen sind religiös-philosophische Bewegungen der Antike, die Erlösung durch geheimes Wissen [Gnosis] vom göttlichen Ursprung und der Überwindung der materiellen Welt suchten).
Diese Auswahlentscheidungen wurden von kirchlichen Autoritäten getroffen und waren oft das Ergebnis theologischer Debatten und Kontroversen. Die Frage, warum bestimmte Evangelien ausgewählt wurden und andere nicht, wirft Fragen nach Autorität, Macht und Interpretation auf.
Auslegung
Darüber hinaus sind die Evangelien oft Gegenstand vielfältiger Auslegungen. Unterschiedliche theologische Traditionen, Konfessionen und Individuen können die Evangelien auf unterschiedliche Weise verstehen und interpretieren. Ein und derselbe Text kann verschiedene Bedeutungen haben. Das kann zu Konflikten, Missverständnissen und sogar Spaltungen innerhalb der christlichen Gemeinschaft führen. Fehlinterpretationen sind nach meiner Einschätzung eine wesentliche Ursache für Missverständnisse. Wenn mit viel Phantasie argumentiert wird, schwindet mein Vertrauen.
Das Dilemma
Die Kirche steht vor der Herausforderung: Die Evangelien müssen möglichst authentisch bleiben. Andererseits können wir die Texte nicht wörtlich verstehen. Die Texte an unsere Kultur anzupassen, scheidet aus. Die umständliche, sehr phantasievolle Interpretation mindert aber ihre Glaubwürdigkeit.
Angesichts der vielen Fehlerquellen dürfen und sollten die Evangelien von jedem Leser kritisch geprüft werden. Blinder Glaube kann zu falschen Bildern und Folgerungen führen. Als Laie kann ich die Texte nicht zuverlässig überprüfen. So bin ich doch wieder auf Theologen angewiesen. Dabei ist mir eine ausgewogene und neutrale theologische Perspektive wichtig, die eine sachlich kritische Auseinandersetzung ermöglicht.
Weise Botschaft
Trotz dieser Herausforderungen und Kontroversen bleibt die Bedeutung der Evangelien für das Christentum unbestreitbar. Sie sind die primären Quellen für das Leben und die Lehren von Jesus Christus, und haben die christliche Theologie, Ethik und Spiritualität maßgeblich geprägt. Ihr Einfluss erstreckt sich weit über religiöse Kreise hinaus und hat auch die Kunst, Literatur und Musik der westlichen Welt beeinflusst.
Zugleich haben die Evangelien über Jahrhunderte hinweg Menschen Trost, Orientierung und Hoffnung gespendet. In ihnen begegnet uns nicht nur ein theologisches System, sondern eine tiefe Menschlichkeit. Die Geschichten von Barmherzigkeit, Heilung, Mitgefühl und Vergebung haben unzählige Menschen inspiriert, ihr Leben neu zu denken – und sich für Gerechtigkeit, Frieden und Gemeinschaft einzusetzen. Diese Kraft zur inneren und äußeren Wandlung ist der bleibende Schatz der Evangelien.
Dennoch: In Anbetracht der oben genannten Überlegungen müssen wir die Evangelien mit einem kritischen und reflektierten Geist interpretieren. Dies erfordert ein Verständnis für die historischen, kulturellen und sprachlichen Kontexte, in denen sie verfasst wurden. Werden die Evangelien mit Blick auf die Fehlerquellen nicht sogar überbewertet? Kann eine Schrift, die mündlich überliefert, mindestens eine Generation später frei niedergeschrieben, mehrfach übersetzt und interpretiert wurde, tatsächlich als „göttliche Offenbarung“ gelten und als „heilig“ bezeichnet werden?
Verkündigung oder Kommunikation?
Die christliche Kirche versteht die „Verkündigung“ der Frohen Botschaft seit jeher als ihre zentrale Aufgabe. Bis heute nimmt sie diesen Auftrag ernst – sei es in der Liturgie, in der Seelsorge oder in der Gemeindearbeit. Doch der Begriff „Verkündigung“ trägt eine lange und nicht unproblematische Geschichte mit sich, die heute neu überdacht werden sollte. Wenn Dialog, Teilhabe und persönliche Glaubenserfahrungen an Bedeutung gewinnen sollen, stellt sich die Frage: Reicht Verkündigung allein noch aus – oder brauchen wir ein neues Verständnis für den Auftrag Jesu?
Der Auftrag Jesu – und was daraus wurde.
Jesus selbst hat seinen Jüngern den Auftrag gegeben: „Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen“ (Markus 16,15). Dieser sogenannte Missionsbefehl bildet bis heute die Grundlage christlicher Verkündigung. Die frühe Kirche nahm diesen Auftrag lebendig auf – mit Begeisterung, Gemeinschaftssinn und einem offenen Ohr für die Menschen ihrer Zeit. Im Laufe der Jahrhunderte jedoch wurde aus der freien, dialogischen Weitergabe des Evangeliums zunehmend eine hierarchische Struktur. Die Kirche institutionalisierte die Verkündigung: Sie wurde Aufgabe der Kleriker, während das gläubige Volk in eine eher passive Rolle rückte.
Priester als exklusive Verkünder.
Vor allem im Mittelalter war der Zugang zum Evangelium stark eingeschränkt. Die Bibel war in lateinischer Sprache verfasst, unverständlich für die Mehrheit der Gläubigen. Laien war es in vielen Fällen sogar verboten, die Bibel selbst zu lesen. Die Auslegung blieb allein dem Klerus vorbehalten. Man fürchtete, dass ungebildete Leser die Heilige Schrift falsch verstehen oder gar die kirchliche Autorität infrage stellen könnten.
Nur geweihte Priester durften das Evangelium im Gottesdienst verkünden – eine Praxis, die – mit Ausnahmen – bis heute im katholischen Ritus gilt. Diese Form der „Einbahn-Kommunikation“ war lange Zeit Ausdruck eines theologischen und institutionellen Machtverständnisses: Der Priester spricht – die Gläubigen hören.
Die Reformation: ein Wendepunkt.
Erst mit der Reformation kam es zu einer grundlegenden Veränderung. Martin Luther forderte das „Priestertum aller Gläubigen“ und übersetzte die Bibel ins Deutsche. Damit legte er die Grundlagen für einen persönlichen Zugang zum Evangelium für jedermann. Dieser Schritt war eine geistige Befreiung. Plötzlich durften Menschen sich selbst ein Bild von Gott und von Jesus machen, das Evangelium im Alltag reflektieren, mit anderen teilen – aber immer noch nur hinter vorgehaltener Hand hinterfragen.
Wenn wir heute vom Evangelium sprechen, sollten wir uns bewusst machen, was Worte bewirken – und was sie verhindern können. Der Begriff Verkündigung klingt nach Einbahnstraße: Eine höhergestellte Person spricht, das Publikum hört zu. Es gibt keine Rückfragen, keinen Widerspruch – oft nicht einmal echtes Verstehen.
Neue Wege für ein altes Wort.
Kommunikation dagegen ist ein gegenseitiger Prozess. Das bedeutet Austausch, Beziehung, Zuhören und gemeinsames Suchen nach Sinn. Das Evangelium entfaltet seine Wirkung nicht allein durch Verkündigung, sondern besonders im geteilten Erleben: im Gespräch, im Miteinander, in gegenseitigem Vertrauen. Denn die gute Nachricht betrifft uns alle – sie ist keine Ansage, sondern eine Einladung. Heute stehen uns viele neue Möglichkeiten zur Verfügung, um das Evangelium zu kommunizieren: Podcasts, soziale Medien, Online-Gottesdienste, christliche Influencer, Musik, Kunst, digitale Bibelgruppen. Noch nie war es so einfach, Menschen außerhalb der Kirchenmauern zu erreichen – niederschwellig, verständlich, persönlich.
Doch es braucht mehr als Technik: Es braucht eine innere Haltung zum Dialog. Das bedeutet, das Evangelium nicht nur zu erzählen, sondern zuzuhören, was Menschen heute wirklich bewegt. Kommunikation heißt: Ich nehme mein Gegenüber ernst – auch wenn er oder sie zweifelt, fragt, widerspricht. Gerade darin ist eine tiefere Wahrheit zu entdecken. Das Evangelium soll nicht von oben herab verkündet, sondern gemeinsam erlebt, hinterfragt und geteilt werden.

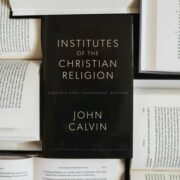


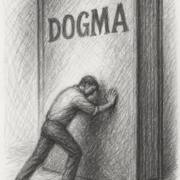



Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!