Brauchen wir die Dogmen noch?
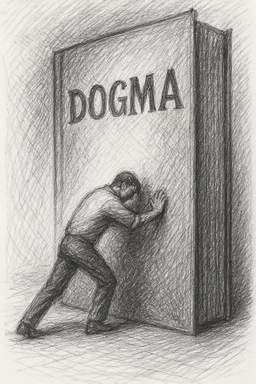 Dogmen waren verbindliche Glaubenssätze, die als unumstößliche Wahrheiten innerhalb der Kirche galten.
Dogmen waren verbindliche Glaubenssätze, die als unumstößliche Wahrheiten innerhalb der Kirche galten.
Inhalt
Dogmen aus Sicht des Jahres 2100
Dogmen wurden von Konzilien beschlossen oder vom Papst erlassen und von den Kirchenführern als „Offenbarung Gottes“ betrachtet. Kritiker sahen in dieser Sichtweise eine ungeheuerliche Anmaßung. Sie bewerteten viele Dogmen als historisch gewachsene Lehraussagen, die in bestimmten Epochen eher der institutionellen Absicherung dienten als einer spirituellen Vertiefung. Man besann sich also auf die Lehren und das beispielhafte Wirken Jesu. So stellte die Synode im Jahr 2040 schließlich fest: „Unser Kompass ist die Bibel und unsere Seele. Es ist vieles überliefert – doch die meisten unserer Dogmen und Lehrsätze können wir ersatzlos streichen. Die Welt braucht sie nicht“.
Jesus selbst lehrte keinen Dogmatismus, sondern lebte Liebe, Vergebung und Barmherzigkeit. In seiner Bergpredigt (Matthäus 5-7) legte er Werte dar, die bis heute relevant sind. Dennoch dauerte es 20 Jahre, bis die von der Synode berufene „Kommission für die Kirchenlehre“ alle Glaubenssätze kritisch hinterfragte und 2050 schließlich den Durchbruch verkündete. Damit war die Zeit vorbei, in der die Ablehnung von Dogmen zur Exkommunikation führen konnte.
Damals galt es als eine Revolution. Heute, 50 Jahre danach, ist es selbstverständlich, sich vom (wissenschaftlich angepassten) Evangelium als Lehrgrundlage, mehr noch vom mystisch kontemplativen Geist leiten zu lassen. Von der Gemeinde bis zur Diözese erfahren die Leitungsgremien eine ungeplante, wundersam geistige Erneuerung, die selbst die römische Kurie beeindruckt hat und bis in Gesellschaftskreise wirkt, die der Kirche noch fern sind. Der anfänglich entrüstete Widerspruch vieler Kleriker wandelte sich mit der Zeit in Verwunderung darüber, wie stark frühere Lehren vom gelebten Beispiel Jesu abweichen konnten.
Beispielhaft stelle ich einige Dogmen heraus:
Auferstehung Jesu
Hintergrund: Biblische Zeugnisse des Neuen Testaments, insbesondere die Evangelien und Paulusbriefe, die die leibliche Auferstehung als zentrales Ereignis bekennen. Rechtfertigung: Osterglaube der ersten Jünger, der Erscheinungen des Auferstandenen und der leeren Grabesüberlieferung, die theologisch als Sieg über den Tod gedeutet wird. Kritik: Mögliche mythische oder symbolische Deutungen und schwer überprüfbare Glaubensaussage außerhalb historisch-wissenschaftlicher Beweisführung.
Dreifaltigkeitslehre (Trinität)
Hintergrund: Die Lehre von der Trinität besagt, dass Gott Vater, Sohn (Jesus Christus) und Heiliger Geist in einer Person sind. Auf den Konzilien von Nicäa (325) und Konstantinopel (381) als Dogma definiert. Rechtfertigung: Die katholische Kirche betrachtet die Trinität als grundlegendes Mysterium des christlichen Glaubens. Es ist das zentrale Dogma, auf dem alle anderen christlichen Glaubenswahrheiten aufbauen. Kritik: Die Vorstellung von drei Personen in einer ist widersprüchlich. Die Überhöhung Jesu als Gott wird von vielen Theologen kritisch gesehen. (Mehr hierzu im Kapitel „Gott, Jesus und der Heilige Geist“).
Unfehlbarkeit des Papstes
Hintergrund: 1870 wurde das Dogma der Unfehlbarkeit des Papstes auf dem Ersten Vatikanischen Konzil definiert. Rechtfertigung: Es sollte die Einheit der Kirche und die Reinheit der Lehre garantieren. Kritik: „Opposistionelle“ bemängelten, dass diese Vorgabe einer kritischen Auseinandersetzung mit der Lehre nicht standhält und einer demokratischen Kirchenstruktur widerspricht.
Unbefleckte Empfängnis Marias
Hintergrund: 1854 als Dogma verkündet, besagte es, dass Maria ohne Erbsünde empfangen wurde. Rechtfertigung: Es sollte Marias besondere Rolle als Mutter Jesu unterstreichen. Kritik: Theologen bemängelten, dass dieses Dogma biblisch schwer begründbar ist.
Leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel
Hintergrund: 1950 als Dogma formuliert, besagte es, dass Maria mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen wurde. Rechtfertigung: Es betonte die herausgehobene Stellung Marias in der Heilsgeschichte. Kritik: Das Dogma stützte sich eher auf kirchliche Tradition als auf explizit biblische Aussagen, was zu kontroversen theologischen Diskussionen führte und für viele Laien wie Theologen nicht mehr akzeptabel war.
Verbindliche Lehre (Doktrinen)
Doktrinen sind verbindliche Lehren der Kirche, die aus Bibel, Tradition und theologischer Reflexion hervorgehen. Sie sind lehramtlich autorisiert, also verbindlich, aber nicht unfehlbar definiert wie Dogmen. Die Gläubigen sind gehalten, diesen Lehren mit „religiösem Gehorsam des Willens und Verstandes“ zuzustimmen – auch wenn sie nicht dieselbe Endgültigkeit wie Dogmen haben. Widerspruch gegen Doktrinen kann zu Ermahnungen, Einschränkungen im kirchlichen Dienst oder theologischer Missbilligung führen – allerdings meist ohne Exkommunikation.
Beispiele für Doktrinen:
Transsubstantiation und Eucharistie
Hintergrund: Die Wandlung von Brot und Wein in Leib und Blut Christi. Rechtfertigung: Es soll die „reale Gegenwart Christi“ in der Eucharistie ausdrücken. Kritik: Rational schwer erfassbar, von protestantischen Kirchen abgelehnt. Nicht mehr zwingend durch Priester zu vollziehen.
Sündenvergebung durch Priester
Hintergrund: Sakrament der Beichte als Weg zur Vergebung. Rechtfertigung: Es bietet eine spirituelle Heilung. Kritik: Kritiker fordern unterstützende Wege zu einer direkteren Verbindung zwischen Gläubigen und Gott, z.B. durch kontemplative Erfahrung.
Vorrang der katholischen Kirche
Hintergrund: Andere christliche Gemeinschaften gelten als defizitär. Rechtfertigung: Die Kirche sieht sich als wahren Weg zum Heil. Kritik: Ökumenische Stimmen forderten mehr gegenseitige Anerkennung christlicher Konfessionen.
Ehe als unauflösliches Sakrament
Hintergrund: Scheidung und Wiederheirat sind nicht erlaubt. Rechtfertigung: Schützt die Heiligkeit der Ehe. Kritik: In manchen Lebensrealitäten wurde diese Lehre als schwer nachvollziehbar und kaum mehr umsetzbar empfunden.
Prädestination
Hintergrund: Die katholische Kirche lehrte eine gemilderte Form der Prädestination. Die Vorausbestimmung menschlicher Geschicke widersprach nicht der Eigenverantwortung des Individuums. Rechtfertigung: Gottes Allwissenheit schließt die freie Entscheidung des Menschen nicht aus. Kritik: Die Verbindung von freiem Willen und Vorherbestimmung bleibt problematisch.
Disziplinarischen Vorschriften – kirchenrechtliche Regeln
Sie sind nicht dogmatischer Natur, aber dennoch verbindlich. Vorschriften und Regeln sind zumindest theoretisch veränderbar. Die Erfahrung zeigte jedoch, dass institutionelle Reformprozesse oft langwierig sind.
Einige Beispiele:
Verbot der Empfängnisverhütung
Hintergrund: Enzyklika Humanae Vitae (1968). Rechtfertigung: Offenheit für neues Leben. Kritik: Verantwortungslos gegenüber modernen Herausforderungen.
Zölibat
Hintergrund: Regel seit dem Mittelalter. Rechtfertigung: Konzentration auf das Priestertum. Kritik: Ein Versprechen wider die Natur und damit gegen Gottes Schöpfung. Viele sehen darin eine lebensfremde Vorgabe, die auch strukturelle Probleme in der Kirche mitbedingen könnte.
Verweigerung der Frauenordination
Hintergrund: Die Kurie argumentiert mit der Vorbildrolle Jesu. Rechtfertigung: Wahrung der Tradition (die sie selbst gebrochen hat). Kritik: Zu Jesu Zeiten gab es Jüngerinnen, im Urchristentum Priesterinnen. Frauenbewegungen fordern Gleichberechtigung.
Verurteilung von Homosexualität
Hintergrund: offizielle Ablehnung homosexueller Beziehungen. Rechtfertigung: Natürliche Ordnung. Kritik: Diese Haltung wurde von vielen als nicht vereinbar mit menschenrechtlichen und ethischen Standards empfunden.
Existenz von Hölle und Fegefeuer
Hintergrund: Seit dem Mittelalter als ewiger Strafort definiert. Rechtfertigung: Sie dient als Konsequenz der freien Entscheidung gegen Gott bzw. als Reinigung vor dem Eintritt ins Paradies. Kritik: Biblische Belege sind schwach; viele Theologen lehnen die Vorstellung einer ewigen Verdammnis als unvereinbar mit Gottes Liebe ab. Diese Lehre geriet zunehmend in die Kritik und wurde theologisch immer schwerer vermittelbar. Sie war selbst im Vatikan schon lange zuvor umstritten und wurde bereits 2030, zu Beginn der Beratungen, ersatzlos gestrichen.
All die genannten Veränderungen sind zwischen 2040 und 2050 in die reformierte Priester/-innen-Ausbildung eingeflossen. Sie haben nach Einschätzung vieler zur Erneuerung kirchlicher Geisteshaltung beigetragen.

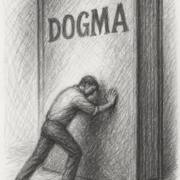






Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!